
Der „Pelz“
Schwarzes Schaffell
Der knielange Mantel aus hochwertigem Wollstoff war früher mit der feingelockten Wolle des aus Vorderasien stammenden Karakulschafs gefüttert und hat daher seinen Namen „Pelz“. An den breiten schwarzen Ärmelaufschlägen tritt das „Persianerfell“ sichtbar hervor
Schnittiger Soldatenrock
Während er am Oberkörper enger geschnitten ist, wird er von der Taille abwärts mit zwei seitlichen Fächerfalten leicht ausgestellt. Sein Schnitt ähnelt dem „Justaucorps“, einem ab Mitte des 17. Jahrhunderts getragenen knielangen Schoßrock der Soldaten.
Knöpfe zur Zier
14 Knöpfe reichen bis zur Taille. Sie sind mit Stoff bespannt und bestickt, während die Knopflöcher nur anmuten. Geschlossen wird der Mantel mit einem Haken am Kragen. Den rückseitigen Schoßschlitz ziert ein aufgesetzter Knopf.
Bedeutungsvolle Pelzfarben
Während die Kleiderordnungen des 17. Jahrhunderts den Salzwirkern gedeckte Braun- und Schwarztöne vorgaben, wurden sie ab dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts farbenfroher. Heute tragen sie Rot als Symbol der Liebe und Blau als Zeichen der Treue zur Brüderschaft. Die Pelze der gewählten Vorsteher, des Ersten Regierenden und des Halloren auf Trauer folgen laut Brüderschaftsordnung der Vorgabe schwarz.
Das „Halbzeug“
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kombinierten die Salzwirker bürgerliche Kleidung mit ihrem Festkleid. Es entstand das „Halbzeug“, bei dem der Pelz einem gängigen Sakko wich. Auf Dreispitz, Degen, Schärpen und Feldbinden wurde verzichtet. Das Festkleid reduzierte sich auf den Latz, die Kniebundhose, die Wollstrümpfe und die Schuhe mit Silberschnallen.
Der Erste Regierende Vorsteher trägt als Insignie die silberne Amtskette.
Details zum Persianerfell
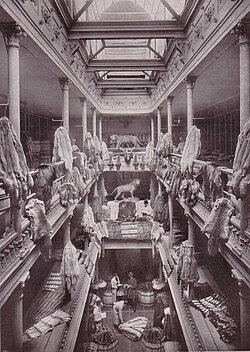
Der Begriff "Persianer" bezieht sich auf das Fell junger Karakulschafe, die nur wenige Stunden bis Tage alt sind. Interessanterweise hat der Name nichts mit dem Herkunftsland zu tun, sondern leitet sich von den historischen Handelsrouten über Persien ab. Ursprünglich stammen diese Felle aus der Region, die inzwischen als Usbekistan bekannt ist. Die Stadt Buchara, einst ein bedeutendes Handelszentrum auf der Seidenstraße, wird hier besonders erwähnt. Heute werden Persianerfelle hauptsächlich in Namibia, Usbekistan und Afghanistan produziert.
Karakul- oder Persianerfell zeichnet sich durch seine einzigartige gelockte oder moirierte Behaarung aus. Die Färbung des Fells variiert, wobei die charakteristische Locke oft in einem tiefen Schwarz erscheint, das manchmal als „Schwarze Rose“ bezeichnet wird. Obwohl sie von Natur aus bereits dunkel sind, wurden Karakulfelle in der Geschichte häufig nachgefärbt, um eine noch intensivere Farbtiefe zu erreichen.
In der Modeindustrie schätzte man das Fell für seine Textur und Haltbarkeit und nutzte es für hochwertige Mäntel und Accessoires. Heute ist die Verwendung von Karakulfell aufgrund ethischer Bedenken und veränderter Modetrends rückläufig. In einigen Kulturen und traditionellen Kleidungsstücken ist es jedoch vereinzelt noch zu finden.
Die Stadt Leipzig war nicht nur ein bedeutender Umschlagplatz für das Salz aus der hallischen Saline, sondern auch ein führendes Zentrum für den Pelzhandel. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert florierte hier der Handel mit Rauchwaren und die Stadt zog mit ihren Pelzmärkten und Messen Händler aus aller Welt an. Die am Leipziger Brühl gehandelten Karakulfelle aus Zentralasien waren von hoher Qualität und gelangten auf diesem Weg in die Hände und an das Festkleid der Halloren.


